
Die Ästhetisierung von Leid
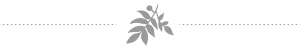
Inhaltsverzeichnis
- Zwischen Schmerz und Schönheit
- Ein Bild, das Geschichte schrieb – und nun selbst zur Geschichte wird
- Das afghanische Mädchen – eine Schönheit, ein Symbol, das schweigt
- Ein Bild wie ein Schnitt durch die Geschichte
- Wenn das Leid schön wird – Susan Sontag und die Frage der Verantwortung
- Die Frage, die bleibt
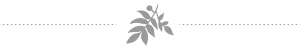
Zwischen Schmerz und Schönheit
Immer wieder stoße ich auf sie: Bilder, die mir nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen. Es sind Fotografien, die mehr zeigen als das Offensichtliche. Bilder, die Kinder in Momenten tiefster Verletzlichkeit festhalten: wehrlos, ausgesetzt, entblößt. Und ich frage mich: Warum gerade diese Bilder? Warum treffen sie mich – uns – so unmittelbar?
Vielleicht, weil ich eine Frau bin. Vielleicht, weil ich Mutter bin. Oder weil wir alle etwas in ihnen sehen, das uns an etwas erinnert. An unsere eigene Hilflosigkeit. An das, was wir schützen wollen.
Zuletzt war es ein Artikel in der DOCMA, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Es ging um ein ikonisches Kriegsbild und die Frage, wer es eigentlich aufgenommen hat. Während die Debatte um die Autorenschaft kreiste, spürte ich jedoch etwas anderes in mir aufsteigen: die alte, unbequeme Frage, wie viel Schönheit ein Bild vom Leid enthalten darf.
Ich möchte keine Antwort geben. Aber ich möchte teilen, was mich bewegt. Vielleicht auch, weil wir zu selten innehalten, um genau das zu tun.
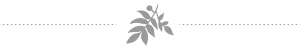
Ein Bild, das Geschichte schrieb – und nun selbst zur Geschichte wird
Jeder kennt diese Bild: Ein Mädchen läuft. Nackt, schreiend, verwundet. Ihre Arme sind vom Napalm gezeichnet, der Schmerz ist wie ein offener Ruf in die Welt. Eine staubige Straße irgendwo in Südvietnam – und mittendrin dieses Bild, das sich eingebrannt hat. 1972 drückte Nick Út den Auslöser. Das Foto ging um die Welt, wurde zum Sinnbild für den Vietnamkrieg und gewann den Pulitzerpreis. Es hatte Gewicht. Es veränderte etwas – in der Wahrnehmung, im Denken, vielleicht sogar in der Geschichte.
Doch über fünfzig Jahre später beginnt dieses Bild, seine Konturen zu verlieren. Die World Press Photo Foundation hat überraschend beschlossen, Nick Úts Anerkennung als Urheber zumindest vorerst auszusetzen. Ein neuer Dokumentarfilm sät Zweifel: War er es wirklich? Oder gehörte der entscheidende Moment jemand anderem?
Der Artikel auf DOCMA.info beleuchtet diese Debatte mit klarem Blick. Auffällig ist, dass der Streit um Kamera, Negativ und Deutungshoheit in den Vordergrund rückt, während das Bild selbst, das Kind und der Schmerz beinahe in den Hintergrund treten.
Dabei war es nicht das erste Mal, dass das Foto für Irritation sorgte. 2016 sperrte Facebook das Bild, da es darin Kinderpornografie sah. Erst öffentlicher Druck zwang das Netzwerk zur Einsicht. Man erkannte den historischen Kontext und das Gewicht des Dokuments.
All das wirft Fragen auf. Was geschieht, wenn ein Bild größer wird als sein Urheber? Wenn es sich löst – von der Hand, die es geschaffen hat, und von der Zeit, in der es entstand? Wer hat dann noch das Recht, über seine Bedeutung zu sprechen? Und was tun wir mit Bildern, die nicht nur Geschichte zeigen, sondern selbst zu einem Teil von ihr geworden sind?
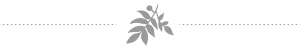
Das afghanische Mädchen – eine Schönheit, ein Symbol, das schweigt
Ein Blick, der bleibt. Grün wie Sturmlicht, durchdringend wie ein Ruf, den niemand hört. 1984 begegnete Steve McCurry in einem Flüchtlingslager in Pakistan einem Mädchen, das später die ganze Welt kennen würde – ohne je selbst gefragt worden zu sein. Sie hieß Sharbat Gula. Doch das wusste lange niemand. Ihr Gesicht prangte 1985 auf dem Cover des National Geographic, wurde millionenfach gedruckt und ausgestellt. Ein Bild, das sprach, aber selbst keine Stimme hatte.
Denn sie selbst wusste nichts von ihrem Ruhm. Während McCurry gefeiert wurde, lebte sie in Armut – eingesperrt in einer Kultur, die das Fotografieren ohne Erlaubnis verbietet. Ihr Porträt war zugleich weltberühmt und zutiefst tabu. Es zeigte nicht nur ihr Gesicht, sondern auch den Bruch mit den Regeln ihrer Herkunft.
Als man sie 2002 aufspürte, wurde ihre Identität mittels eines Iris-Scans bestätigt. Doch der Preis dafür war hoch. Das Bild, das sie berühmt machte, war zugleich der größte Verstoß gegen alles, was sie schützte.
Im Jahr 2016 wurde McCurry für digitale Retuschen in anderen Bildern kritisiert. Er selbst erklärte, kein Fotojournalist mehr zu sein, sondern ein „visueller Erzähler“. Bei diesem einen Bild stellt sich jedoch die Frage mit Nachdruck: Wie viel Inszenierung darf es sein? Und wo verläuft die Grenze zwischen Dokument und Deutung?
Auch nach ihrer Wiederentdeckung blieb Sharbat Gula eine Gejagte. Wegen gefälschter Papiere wurde sie 2016 in Pakistan verhaftet. Später nahm Afghanistan sie auf und gab ihr ein Haus und ein wenig Sicherheit. Doch mit dem Fall Kabuls im Jahr 2021 kam erneut der Bruch – Italien gewährte ihr schließlich Asyl.
Heute ist sie über fünfzig. Ihr Gesicht trägt die Spuren vieler Leben – von Krieg, Flucht und einem Bild, das sie nie selbst gewählt hat. Was bleibt, ist ein Porträt, das wirkt wie ein Denkmal. Und doch mahnt es uns: Fotografie kann sichtbar machen, aber auch verschweigen.
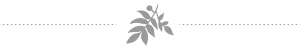
Ein Bild wie ein Schnitt durch die Geschichte
Von Kim Phúc über Sharbat Gula bis zu Alan Kurdi: Drei Kinder, drei Fotografien, drei Augenblicke, die sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt haben. Und doch haben wir sie möglicherweise nie wirklich verstanden. Denn was sie verbindet, ist nicht nur ihr Schmerz. Es ist auch die Art, wie dieser Schmerz ins Bild gesetzt, betrachtet, geteilt und genutzt wurde.
Im Jahr 2015 kniete die türkische Fotojournalistin Nilüfer Demir am Strand von Bodrum. Vor ihr lag der leblose Körper eines kleinen Jungen. Alan Kurdi, drei Jahre alt, rotes T-Shirt, blaue Hose, das Gesicht im Sand. Ein Bild von erschütternder Ruhe. Es wurde zur Ikone der syrischen Flüchtlingskrise. Es stand für vieles – und zeigte dabei doch einen konkreten Menschen.
Dieses Bild war nicht laut, nicht heroisch. Und gerade deshalb traf es ins Mark. Doch wie lange hielt das Erschrecken an? Und was blieb davon – jenseits der Schlagzeilen?
Auch wenn hier eine Frau den Auslöser gedrückt hat, bleibt das Muster erkennbar: Es ist der westliche Blick, der entscheidet, wann und wie Leid gezeigt wird. Und oft ist es dieselbe westliche Welt, die Teil dieses Leids ist. Als Handelnde. Als Schweigende. Als Profiteure der Systeme, die Grenzen ziehen und Menschen zurücklassen.
Diese Fotografien dokumentieren nicht nur. Sie spiegeln Machtverhältnisse wider. Sie zeigen die Beziehung zwischen denen, die abbilden, und jenen, die abgebildet werden. Zwischen Sichtbarkeit und Schweigen. Zwischen Anteilnahme und Aneignung.
Und immer wieder schwingt die Ästhetisierung des Leids mit.
Ein großes Wort, schwer. Und doch beschreibt es einen Punkt, an dem sich alles verdichtet. Wenn Leid in Schönheit gerinnt, wenn Elend zu einem perfekten Bild wird, droht der Mensch dahinter zu verschwinden. Dann wird das Kind zur Chiffre. Die Frau wird zum Zeichen. Das Gesicht wird zur Fläche für fremde Bedeutungen.
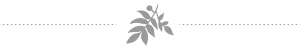
Wenn das Leid schön wird – Susan Sontag und die Frage der Verantwortung
Was geschieht, wenn der Schmerz uns nicht nur trifft, sondern uns mit einer fast verstörenden Schönheit berührt? Wenn wir nicht nur erschüttert sind, sondern über Komposition, Licht und Linienführung staunen?
Susan Sontag hat sich dieser unbequemen Frage gestellt. Ihr Blick fiel auf die großformatigen, meisterhaft komponierten Schwarzweiß-Fotografien von Sebastião Salgado. Seine Bilder zeigen Elend, Hunger und Vertreibung. Und doch sind sie schön. Zu schön?
Für Sontag war genau das der wunde Punkt. Wenn das Bild zu sehr zur Kunst wird, verliert das Dargestellte an Schärfe. Der Schock rahmt sich selbst. Der Schmerz wird ästhetisch – und damit ein Stück weit entfernt.
In On Photography schrieb sie bereits: Fotografie ist immer auch ein Akt der Aneignung. Wer ein Bild macht, besitzt für einen Moment die Wirklichkeit eines anderen. Wird dieses Bild dann vervielfältigt, verkauft oder prämiert, stellt sich zwangsläufig die Frage: Wer profitiert vom Schmerz? Und wer trägt seine Last?
Gerade weil Salgado mit solcher Sorgfalt arbeitet, stellt sich für Sontag die moralische Frage besonders deutlich: Dürfen wir das Leid der Welt bewundern? Ist es noch ein Zeugnis oder schon eine Veredelung?
Wenn wir ein Foto wegen seiner Schönheit lieben, können wir es dann noch als ehrlichen Ausdruck von Not empfinden?
Es ist ein Balanceakt. Zwischen Ethik und Ästhetik. Zwischen Verantwortung und Wirkung. Zwischen dem, was das Bild zeigt, und dem, was wir darin sehen wollen.
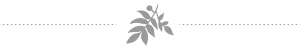

In meinem Buch „Gefühl und Verstand – Naturfotografie“ habe ich mich intensiv mit dieser Frage der „Ästhetisierung von Leid“ beschäftigt, auch weil ich Sebastião Salgado, vor allem für seine Landschaft- und Naturaufnahmen, bewundere.
Ich hätte gerne einmal ein Gespräch mit ihm geführt. Das ist leider nicht mehr möglich, er ist am 23. Mai 2025 in Paris verstorben. Sein Tod berührt mich mehr, als ich erwartet hätte. Denn seine Bilder haben mich immer wieder begleitet. Ich habe gespürt, dass hinter jeder Aufnahme ein Mensch stand, der nicht nur gesehen, sondern gefühlt hat. Diese Tiefe, sie wird fehlen. Aber was bleibt, ist sein Werk – nicht nur seine Bilder sondern auch sein Aufforstungsprojekt auf seiner Bulcão Farm in Brasilien. Und eine stille Dankbarkeit.
Bild: Fernando Frazão/Agência Brasil Bildquelle
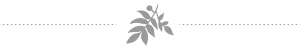
Die Frage, die bleibt
Darf man Leid zeigen? Und wenn ja, wie und wieviel? Es rahmen, ins Licht setzen, festhalten? Darf man es schönmachen?
Bilder können berühren. Sie können etwas in uns auslösen, das länger anhält als ein Gedanke. Manchmal bringen sie uns zum Handeln. Manchmal machen sie uns stumm.
Vielleicht liegt das Problem nicht im Bild selbst, sondern darin, was wir daraus machen. Wenn nicht mehr das Kind, sondern der Fotograf im Vordergrund steht. Wenn wir das Leid sehen – und dann wieder vergessen.
Mir fällt auf, wie selten ich die Gesichter der Kinder aus Gaza sehe. Wie schweigsam dieser Krieg geworden ist, obwohl wir seine Zahlen kennen. Über viertausendneunhundert tote Kinder unter fünf Jahren. Es gibt kein Bild, keinen Aufschrei, kein globales Echo.
Julian Assange trug bei den Filmfestspielen in Cannes ein T-Shirt mit ihren Namen. Kein Foto. Nur Buchstaben. Und trotzdem war es ein Bild – eines, das man nicht teilen, liken oder einrahmen würde.
Ich merke, wie sehr mich solche Bilder beschäftigen. Vielleicht, weil ich Mutter bin. Vielleicht, weil ich weiß, wie gezielt solche Motive gewählt werden. Weil sie berühren. Und weil genau das gewollt ist.
Aber ist das richtig?
Ich weiß keine Antwort. Ich schreibe, um die Frage nicht aus den Augen zu verlieren.
Nicht nur: Wie viel Leid darf man zeigen?
Sondern auch: Wie viel davon darf nicht länger unsichtbar bleiben?

🕊️ Hinweis: Ich freue mich über persönliche, wertschätzende Kommentare. Mein Blog ist ein geschützter Raum für respektvollen Austausch – polemische, verletzende oder themenfremde Beiträge werden nicht freigeschaltet.
Mit dem Absenden erklärst du dich mit der DSGVO einverstanden.