
Japanische Ästhetik in Serien: Zwischen Shogun und Rurouni Kenshin
In den letzten Wochen wurde mir in den sozialen Medien immer wieder Werbung für die neue Shogun-Serie angezeigt. Als Fan von japanischen bzw. ostasiatischen Serien und Filmen wollte ich natürlich unbedingt reinschauen. Ich bin mittlerweile so alt, dass ich mich sogar dunkel an die Shogun-Serie von 1980 mit Richard Chamberlain erinnern kann. Anfang der 2000er Jahre war ich begeistert vom Film Last Samurai. Einer der Hauptdarsteller, der Japaner Hiroyuki Sanada, spielte sowohl 1980 im Shogun (damals als 20-Jähriger) als auch 2024 (als Fürst Toranaga) in Shogun mit.
Nachdem ich nun die ersten drei Folgen angeschaut habe, bin ich von der Neuverfilmung wenig begeistert. Allerdings stört mich nicht, dass die Texte aus dem Japanischen nicht synchronisiert sind und als Lesetext eingeblendet werden, was von vielen bisher als negativ kritisiert wurde. Ich bin es gewohnt, ostasiatische Serien in der Originalsprache zu schauen und bevorzuge es mittlerweile sogar.
Stattdessen habe ich etwas ganz anderes zu kritisieren, was mir in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen ist. Die Serie Shogun ist eine US-amerikanische Verfilmung. Allerdings haftet diesen Verfilmungen oft eine postkolonialistische Attitüde an. Es stellt sich die Frage, warum bisher niemand kritisiert hat, dass die Japaner in der Serie mit schon fast kannibalistischen Ambitionen dargestellt werden, die gerne Ausländer in großen Töpfen kochen um „näher an den Tod heranzukommen“. Wie krank muss der Regisseur sein, so etwas darzustellen?
Die neue Serie wurde im Vorfeld als die neue „Game of Thrones“ gefeiert. In Bezug auf die Darstellung von Gewalt, insbesondere psychischer Gewalt, trifft das zu. Es war für mich schon in Game of Thrones an vielen Stellen unzumutbar, was gezeigt wurde. Die Kochszene ist ekelerregend und menschenunwürdig. In einer anderen Szene wird eine japanische Frau in einer entwürdigenden Sexszene dargestellt, die ich mir wirklich nicht ansehen möchte.
Das ist das eine. An dieser Stelle möchte ich gerne einen Vergleich zu einer anderen japanischen Serie ziehen. Eine von Japanern selbst produzierte Serie ist „Rurouni Kenshin“ mit Takeru Satô als Hauptdarsteller. Bei Netflix sind die beiden Teile „The Beginning“ (1) und „The Final“ (2) verfügbar.
Während in „Shogun“ die Herrschaft des Shoguns und seiner Samurai glorifiziert wird, thematisiert „Rurouni Kenshin“ den Befreiungskampf gegen die Shogun-Herrscher.
Obwohl beide Serien mit japanischstämmigen Schauspielern besetzt sind, unterscheiden sie sich sehr in ihrer Sprache. Es ist schwer zu erklären, warum das so ist, aber es wird deutlich, wenn man beide Serien nacheinander schaut. Rurouni Kenshin hat eine viel feinere Sprache und die japanische Aussprache klingt ganz anders, hat eine andere Schwingung. Rurouni Kenshin wurde komplett am japanischen Set gedreht, während Shogun größtenteils in Kanada produziert wurde. Doch noch ein viel größerer Unterschied besteht in der Bildsprache. Ja, auch Rurouni Kenshin ist eine Serie mit vielen Gewaltdarstellungen. Aber sie werden anders dargestellt. Man spürt deutlich, dass hier eine andere Philosophie im Hintergrund wirkt.
In der japanischen Kultur gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen allen traditionellen Künsten: der Begriff des „Weges“ (道 sino-japanisch „dô“ oder reinjapanisch „michi“). Das reicht von der Teezeremonie (茶道 Sadô) über Kalligraphie (書道 Shodô), Duftzeremonie (香道 Kôdô) bis zur Blumensteckkunst (華道 Kadô) und den Kampfkünsten (武道 Budô) wie Bogenschießen (弓道 Kyûdô) oder Schwertfechten (剣道 Kendô).
In Shogun spürt man nichts von der tiefgründigen japanischen Philosophie. Stattdessen werden hier nur rohe Gewalt und plumpe Dialoge gezeigt.
Ein Beispiel aus Rurouni Kenshin: Hier wird nicht nur die gesellschaftliche Problematik der gewalttätigen Shogun-Herrschaft thematisiert, sondern es wird auch mit Bildern aus den verschiedenen Jahreszeiten gearbeitet. Von Regen (5. Jahreszeit in Japan) über fallende Kirschblüten bis hin zum verwehenden roten Ahornblättern (Momijigari) und fallendem Schnee – wunderbare Darstellungen. Die Liebesgeschichte zwischen Kenshin und Tomoe (Kasumi Arimura) berührt durch Andeutungen und kommt ohne pornographische Darstellungen aus. Die oft sehr leise gesprochenen Dialoge leben von Andeutungen, Zwischentönen, von einer Tiefe, die man in angelsächsischen Verfilmungen verzweifelt sucht, aber nicht findet.
Fazit:
Wer auf gewalt[tät]ige Bilder und dumpfe Dialoge steht und sich nur berieseln lassen will, kann seinen Samstagabend mit der neuen Shogun-Verfilmung sicherlich gut verbringen. Wer allerdings mehr will, sollte sich nach anderen japanischen Filmen und Serien umsehen. Es muss nicht unbedingt Rurouni Kenshin sein. Auch First Love mit Takeru Satō ist ein Film mit sensiblen Dialogen und Bildern. Oder „Silent“ ist eine original japanische Serie mit Meguro Ren in der Hauptrolle. Die Serie handelt von einem jungen Mann, der nach und nach sein Gehör verliert und dadurch sein soziales Umfeld.

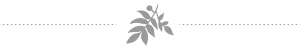


🕊️ Hinweis: Ich freue mich über persönliche, wertschätzende Kommentare. Mein Blog ist ein geschützter Raum für respektvollen Austausch – polemische, verletzende oder themenfremde Beiträge werden nicht freigeschaltet.
Mit dem Absenden erklärst du dich mit der DSGVO einverstanden.